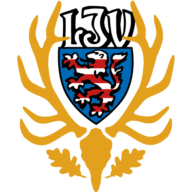
Jägerinnen und Jäger in Hessen

Reh und Hirsch gehören zur Artenvielfalt!
Die Trockenheit der letzten Jahre macht den Bäumen in unseren Wäldern schwer zu schaffen; sie leiden unter Stress und werden anfälliger für Pilzkrankheiten und Schädlinge wie dem Borkenkäfer. Einer der am stärksten betroffenen Baumarten ist die Fichte. Die Folgen sind Landauf und Landab zu sehen: kahle Stellen insbesondere dort, wo Fichten in Reinkultur gepflanzt wurden. Die Forstwirtschaft steht nun vor der Herausforderung, einen möglichst vielfältigen Mix aus Baumarten wie Weiß- oder Rottanne, Douglasie oder verschiedenen Laubbäumen anzupflanzen. Diese sollen die langen Trockenphasen in den heißen Sommermonaten besser überstehen, also klimaresistent sein.
Doch ständig steigende Abschussvorgaben für Wildtiere können und dürfen nicht die alleinige Lösung sein. Rehe und Hirsche gehören genauso zur Artenvielfalt des Waldes wie Luchs, Hirschkäfer oder die Bechsteinfledermaus.
Statt ausschließlich auf die Büchse zu setzen, sollten frisch gepflanzte Bäume durch Einzelschutzmaßnahmen wie z. B. Aufwuchshüllen oder durch Forstgatter geschützt werden. Der Landesjagdverband Hessen hat bereits im Jahr 2019 einen 4-Punkte-Plan zu einer intelligenten Jagdstrategie auf Basis von Lebensraumkonzepten und wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitet und diese in der Broschüre „Gemeinsam für einen klimastabilen Wald – Wald mit Wild ist möglich“ vorgestellt.
Hintergrund:
Aufgrund der Trockenheit und des Borkenkäfers sind in Hessen wie auch in anderen Bundesländern die Fichten, insbesondere dort, wo sie allein ohne andere Baumarten – also als Monokultur gepflanzt wurden – am stärksten betroffen. Die Forstwirtschaft steht nun vor der großen Herausforderung, Baumarten wie z. B. die Weiß- und Rottanne aber auch die Douglasie anzupflanzen. Diese Baumarten sollen die langen Trockenphasen in den heißen Sommermonaten besser überstehen, also klimaresistent sein.
Auch die natürliche Verjüngung, wie z. B. von Buchen und Eichen, soll ein fester Bestandteil des Waldumbaus sein.
Viele nichtheimischen Baumarten sind jedoch für Hirsche und Rehe besonders attraktiv und müssen daher vor übermäßigem Wildverbiss geschützt werden. Dies geschieht vielerorts schon mit sogenannten „Wuchshüllen“, die um jeden einzelnen Baumsetzling gelegt werden. Eine eckige oder auch abgerundete Hülle sorgt dafür, dass die jungen Triebe, insbesondere die Spitzen (Terminaltrieb) ungehindert wachsen können und nicht von den Rehen oder Hirschen angeknabbert werden. Dabei handelt es sich um eine Einzelschutzmaßnahme. Die Hüllen umgeben den Haupttrieb der jungen Bäume so lange bis diese „aus dem Äser“ der Wildtiere herausgewachsen sind, also die Tiere die Baumspitze nicht mehr erreichen können. Eine alternative Schutzmaßnahme sind Holzgatter, die eine gesamte Neuanpflanzungsfläche vor dem Eindringen von Reh und Hirsch schützen.
Parallel setzen sich die Jägerinnen und Jäger im Rahmen einer Jagdstrategie dafür ein, dass dort schwerpunktmäßig gejagt wird, wo Wildschäden z. B. durch Verbiss an jungen Trieben entstehen oder die natürliche Verjüngung vorangetrieben werden soll. Im Gegenzug sollen in weniger gefährdeten Waldbereichen Wildruhezonen mit Wildwiesen eingerichtet werden. Spezielle Baumarten (Weichgehölze) wie Weiden, Aspen, Pappeln und Eberesche können dem Wild als Nahrungsquelle dienen und liefern vielen anderen Arten vom Schmetterling bis zum Eisvogel neue Lebensräume.
Besonders wichtig ist es auch, andere Einflussfaktoren, wie z. B. den Freizeitdruck, der während der Corona-Pandemie stark angestiegen ist, gezielt zu lenken. Denn: Können Wildtiere in der Dämmerung nicht auf Wiesen- und Weideflächen ziehen, weil sie auch in der Nacht z. B. durch Mountainbiker, Jogger oder Geocacher gestört werden, ziehen sich die Tiere in die dunklen Waldbereiche zurück und müssen dort ihren Hunger stillen. Deshalb steht die Jägerschaft an vielen Orten mit den Gemeinden und Landkreisen in Verbindung, um z. B. durch gut ausgebaute und beschilderte Wanderwege eine Reduzierung von Stressfaktoren für die Wildtiere erreichen.

… damit der Hase in Hessen gut leben kann!
Um die Artenvielfalt zu erhalten, investieren Jägerinnen und Jäger viel Zeit und privates Geld in Maßnahmen, die insbesondere auch den Arten des Offenlandes, wie z. B. dem Feldhasen und dem Rebhuhn einen attraktiven Lebensraum bieten.
Gemeinsam mit Landwirten werden z. B. Brach- bzw. Blühflächen angelegt oder Hecken und Feldgehölze gepflegt, so dass diese möglichst vielen Tierarten Unterschlupf und Nahrung bieten.
Dabei wird insbesondere auch der Feldhase bei der Nahrungssuche unterstützt. Mit der Anlage von kräuterreichen Streifen, der sogenannten Hasenapotheke, wird dafür gesorgt, dass die Häsin eine sehr fettreiche Milch produzieren und ihre Jungen mit ausreichend Energie für die kalten und oft nassen Winternächte versorgen kann. In trockenen und heißen Sommern bringen Jägerinnen und Jäger Tränken aus oder sorgen mit der Anlage von Kleinstgewässern für eine bessere Wasserversorgung. So helfen sie nicht nur dem Wild, sondern unterstützen alle Feldarten, von der Amsel bis zur Zwergmaus.
Bei Feldvogelarten wie dem Rebhuhn oder dem Fasan helfen zudem ergänzende Fütterungen. Die angebotene energiereiche Nahrung in Form von Getreidekörnern kompensiert besonders in der kalten Jahreszeit das fehlende natürliche Nahrungsangebot und wirkt sich positiv auf die Vitalität und damit auch auf den Bruterfolg im Frühling aus. Außerdem müssen die Vögel zur Futteraufnahme viel weniger Zeit außerhalb der schützenden Deckung verbringen und haben so ein deutlich geringeres Risiko von einem Beutegreifer gefressen zu werden.

Wildtiere müssen wandern können!
Hirsche gelten für viele Menschen als die „Könige der Wälder“. Dass dieser Mythos nichts mit den realen Lebensbedingungen dieser Tiere zu tun hat, zeigt ein Film des Wiesbadener Filmautors Markus Stifter. Prof. Dr. Dr. habil. Gerald Reiner von der Justus-Liebig-Universität Gießen als auch die Deutsche Wildtier Stiftung zeichnen darin für das Rotwild eine düstere Prognose: Ganze Populationen könnten bereits in 10 Jahren nicht mehr überlebensfähig sein.
Denn die Lebensräume der Tiere sind durch Autobahnen, Bundesstraßen oder Bahnschienen durchschnitten. Hinzu kommen die amtlich festgelegten Rotwildbezirke. Laut den Landesverordnungen darf das Rotwild die behördlich ausgewiesenen Lebensräume nicht verlassen. Geschieht es dennoch, schreiben die Verordnungen den konsequenten Abschuss dieser Tiere vor. Ein Wechsel zwischen den einzelnen Lebensräumen ist vielerorts nicht mehr möglich. In den isolierten Gebieten steigt die Inzuchtrate unter den Tieren immer weiter an.
Damit sinkt die Anpassungsfähigkeit der Populationen an sich verändernde Umweltbedingungen durch zum Beispiel den Klimawandel. Manche Folgen der Inzucht sind aber bereits heute offensichtlich und haben mehrfach zu Missbildungen, wie z. B. verkürzten Unterkiefern bei hessischen Rotwildkälbern geführt. Es steht zu befürchten, dass parallel zu diesen Befunden auch die Krankheitsresistenz sowie die Fruchtbarkeit der Tiere bereits beeinträchtigt ist.
Prof. Dr. Jürgen Ellenberger, Präsident des Landesjagdverbandes Hessen, der auch Präsidiumsmitglied des Deutschen Jagdverbandes ist, fordert einen festen Etat von 50 Millionen Euro pro Jahr im Haushaltsplan des Bundes, um Lebensräume, die durch Autobahnen zerschnitten wurden, z.B. mit Grünbrücken wieder zu vernetzen. Die Abschaffung der Rotwildgebiete, die freie Wanderung von männlichen Tieren und der Bau von Querungshilfen (Grünbrücken) seien zwingend notwendig, damit das Rotwild in den deutschen Wäldern langfristig überleben könne.
Die sogenannten Querungshilfen bzw. Grünbrücken sind somit für viele Wildtiere unerlässlich. Sie ermöglichen eine Wanderung der Tiere über Autobahnen hinweg und sichern so die genetische Vielfalt, die ebenfalls ein Teil der Biodiversität ist.
Den Film „Hessens Wälder ohne Hirsche“ von Markus Stifter können Sie unter folgendem Link kostenfrei ansehen: www.hirsche-in-gefahr.de/ oder direkt auf Youtube.

Wir lieben und schützen alle Tiere!
Ehrenamtliches Engagement für unsere Wildtiere
Die von Jägerinnen und Jägern im Ehrenamt geleiteten Jagdvereine und Hegegemeinschaften ermöglichen die gezielte Absprache und Durchführung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz über mehrere tausend Hektar Fläche und sorgen zudem für eine bessere Vernetzung der Lebensräume. Gemeinsam mit verschiedenen Experten werden, in sogenannten Lebensraumkonzepten oder Lebensraumgutachten, die Bedürfnisse der heimischen Wildtiere analysiert und in den Vordergrund gestellt. Sie finden beispielsweise maßgeblich Beachtung bei der Planung von Äsungsflächen oder der Ausweisung von Wildruhezonen.
Jägerinnen und Jäger übernehmen im Ehrenamt vielseitige Verantwortung
Jägerinnen und Jäger engagieren sich in vielen Bereichen zum Schutze unserer Wildtiere und übernehmen im Ehrenamt verantwortungsvolle Aufgaben. So sind sie zum Beispiel bei Wildunfällen die wichtigsten Ansprechpartner der Polizei und suchen mit ihren speziell ausgebildeten Hunden nach den verletzten Tieren. Auch in der Seuchenprävention nehmen sie gemeinsam mit ihren Hunden eine wichtige Aufgabe wahr. Als sogenannte Kadaver-Suchhunde-Gespanne sind sie ausgebildet im Falle des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest die verendeten Tiere möglichst schnell zu finden, so dass der Seuchenherd identifiziert und die weitere Verbreitung der Krankheit möglichst verhindert werden kann. Im Frühjahr unterstützen sie die Landwirte dabei, die Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen, Junghasen oder Gelegen abzusuchen. Hierbei investieren viele Jägerinnen und Jäger aber auch Jagdvereine, Hegegemeinschaften oder Jagdgenossenschaften in Flugdrohnen, die ausgestattet mit modernster Wärmebildtechnik, die Suche nach den versteckten Jungtieren oder Gelegen deutlich erleichtert. Als Mitglieder eines anerkannten Naturschutzverbands sind zudem viele Jägerinnen und Jäger ehrenamtlich in kommunalen oder Kreisbeiräten sowie lokalen Expertengruppen aktiv. Sie geben hier Fachwissen weiter und vertreten im Rahmen der öffentlichen Beteiligung, zum Beispiel bei der Planung von Straßen und Siedlungsgebieten, die Interessen der Wildtiere.

Jägerinnen und Jäger sind Natur- und Artenschützer
Um die Artenvielfalt zu erhalten, investieren Jägerinnen und Jäger viel Zeit und privates Geld in Maßnahmen, die dem weiteren Rückgang dieser Arten entgegenwirken. Gemeinsam mit Landwirten stellen sie Lebensräume wieder her und erhalten diese; sie legen zum Beispiel Brach- bzw. Blühflächen an oder pflegen Hecken und Feldgehölze, so dass sie möglichst vielen Tierarten Unterschlupf und Nahrung bieten. Bei Feldvogelarten wie dem Rebhuhn oder dem Fasan helfen zudem Fütterungen. Die angebotene energiereiche Nahrung in Form von Getreidekörnern kompensiert besonders in der kalten Jahreszeit das fehlende natürliche Nahrungsangebot und wirkt sich positiv auf die Vitalität und damit auch auf den Bruterfolg im Frühling aus. Außerdem müssen die Vögel zur Futteraufnahme viel weniger Zeit außerhalb der schützenden Deckung verbringen und haben so ein deutlich geringeres Risiko von einem Beutegreifer gefressen zu werden. Aber auch der Feldhase wird bei der Nahrungssuche unterstützt. Mit der Anlage von kräuterreichen Streifen, der sogenannten Hasenapotheke, wird dafür gesorgt, dass die Häsin eine sehr fettreiche Milch produzieren und ihre Jungen mit ausreichend Energie für die kalten und oft nassen Winternächte versorgen kann. In trockenen und heißen Sommern bringen Jägerinnen und Jäger Tränken aus oder sorgen mit der Anlage von Kleinstgewässern für eine bessere Wasserversorgung. So helfen sie nicht nur dem Wild, sondern unterstützen alle Feldarten, von der Amsel bis zur Zwergmaus.

Hegegemeinschaften- ehrenamtliches Engagement für unsere Wildtiere
Am effektivsten wirken all diese Maßnahmen, wenn sie nicht nur in einzelnen Revieren durchgeführt werden, sondern benachbarte Reviere ihre Hegemaßnahmen untereinander koordinieren und gemeinsam umsetzen. Hierfür stellen die Hegegemeinschaften, ein Zusammenschluss von Revieren einer bestimmten Region, eine wichtige Grundlage dar. Die von Jägerinnen und Jägern im Ehrenamt geleiteten Organisationen ermöglichen die gezielte Absprache und Durchführung von Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz über mehrere tausend Hektar Fläche und sorgen zudem für eine bessere Vernetzung der Lebensräume. Gemeinsam mit verschiedenen Experten werden, in sogenannten Lebensraumkonzepten oder Lebensraumgutachten, die Bedürfnisse der heimischen Wildtiere analysiert und in den Vordergrund gestellt. Sie finden beispielsweise maßgeblich Beachtung bei der Planung von Äsungsflächen oder der Ausweisung von Wildruhezonen.
Jägerinnen und Jäger übernehmen im Ehrenamt vielseitige Verantwortung
Jägerinnen und Jäger engagieren sich in vielen Bereichen zum Schutze unserer Wildtiere und übernehmen im Ehrenamt verantwortungsvolle Aufgaben. So sind sie zum Beispiel bei Wildunfällen die wichtigsten Ansprechpartner der Polizei und suchen mit ihren speziell ausgebildeten Hunden nach den verletzten Tieren. Auch in der Seuchenprävention nehmen sie gemeinsam mit ihren Hunden eine wichtige Aufgabe wahr. Als sogenannte Kadaver-Suchhunde-Gespanne sind sie ausgebildet im Falle des Ausbruchs der afrikanischen Schweinepest die verendeten Tiere möglichst schnell zu finden, so dass der Seuchenherd identifiziert und die weitere Verbreitung der Krankheit möglichst verhindert werden kann. Im Frühjahr unterstützen sie die Landwirte dabei, die Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen, Junghasen oder Gelegen abzusuchen. Hierbei investieren viele Jägerinnen und Jäger aber auch Jagdvereine, Hegegemeinschaften oder Jagdgenossenschaften in Flugdrohnen, die ausgestattet mit modernster Wärmebildtechnik, die Suche nach den versteckten Jungtieren oder Gelegen deutlich erleichtert. Als Mitglieder eines anerkannten Naturschutzverbands sind zudem viele Jägerinnen und Jäger ehrenamtlich in kommunalen oder Kreisbeiräten sowie lokalen Expertengruppen aktiv. Sie geben hier Fachwissen weiter und vertreten im Rahmen der öffentlichen Beteiligung, zum Beispiel bei der Planung von Straßen und Siedlungsgebieten, die Interessen der Wildtiere.